„Nachdem das weltweite Finanzsystem fast kollabierte, wurde deutlich, dass wir Ökonomen tatsächlich nicht wissen, wie die Welt funktioniert. Es ist mir zu peinlich, weiterhin Wirtschaftswissenschaften zu unterrichten, was ich viele Jahre lang getan habe. Ich werde stattdessen modernen koreanischen Film unterrichten“, verkündete Uwe Reinhardt, ein Wirtschaftswissenschaftler der Universität Princeton, auf der ersten Seite seines Entwurfs für einen Vortrag mit dem Titel „Einführung in den koreanischen Film“.
Wie Sie richtig geraten haben, handelt es sich um einen Scherz. Der Wirtschaftswissenschaftler, der gern koreanische Fernsehserien mit seiner Familie ansieht, machte diesen Scherz erstmals während eines Dinners in Hualien, Taiwan, bei einer Konferenz über die nationalen Gesundheitssysteme von Korea und Taiwan. Auch wenn es nur ein Witz war, sagte er in einem späteren Interview, dass die Frage berechtigt sei, warum koreanische Fernsehserien so beliebt in China, Japan, Taiwan und vielen anderen Teilen Ostasiens sind und dass Soziologen und Psychologen diese Entwicklung untersuchen sollten.
Viele Gelehrte haben in der Tat damit begonnen, die jüngst entstandene Popularität koreanischer Popmusik, Kinofilme und Fernsehserien in Ostasien und anderswo zu untersuchen, ein Trend, den man „Koreanische Welle” oder in Kurzform „Hallyu” nennt. Immer mehr Akademiker erforschen diese Strömung, die zunächst als kurzfristiges Phänomen betrachtet wurde, nun aber länger anhält als erwartet.
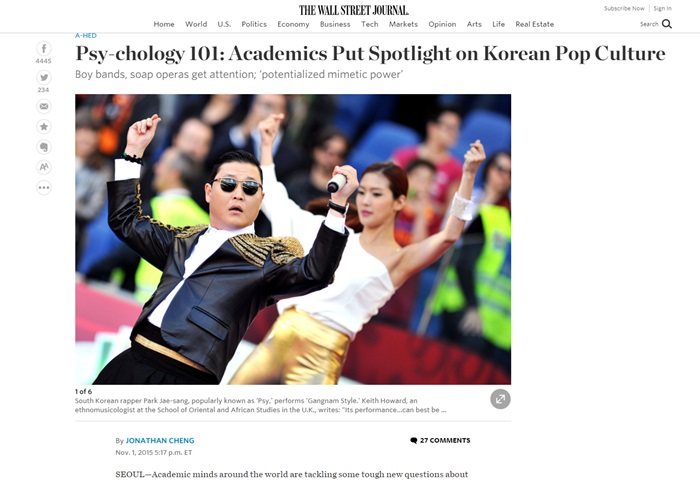
Diese jüngste akademische Strömung, in deren Rahmen die koreanische Populärkultur beleuchtet wird, wurde am 1. November im „Wall Street Journal“ diskutiert. Die anhaltende Popularität von koreanischer Popmusik und koreanischen TV-Shows haben die Neugierde der akademischen Welt geweckt: Eine wachsende Zahl von Aufsätzen aus dem Bereich der Koreastudien (auch Koreanistik) konzentriert sich auf dieses Phänomen, so die Zeitung. Es werden fortlaufend weitere wissenschaftlich belegte Publikationen und wissenschaftliche Einzeldarstellungen herausgebracht, und die Themen in den Abhandlungen aus dem Bereich Koreastudien weichen nun von traditionellen Themen wie Buddhismus, Konfuzianismus und Patriarchat ab, hieß es.
Die Zeitung führte das Beispiel von Keith Howard an, eines Professors der School of Oriental and African Studies in London. Howard, dessen Forschungsgebiet die koreanische volkstümliche Musik ist, wurde bei einer Konferenz „niedergeschrien”, als er eine Abhandlung über koreanische Pop-Balladen präsentierte. Das war im Jahr 1999 bei der jährlichen Konferenz der Association for Korean Studies in Europe. Er ließ sich jedoch niemals entmutigen und führte seine Forschungen über die koreanische Popmusik fort. In seinem Aufsatz, der in diesem Jahr veröffentlicht wurde, analysiert er Psys „Gangnam Style” und kommt zu dem Schluss, dass er „eine potentialisierte nachahmende Kraft hat, wie eine Art umgekehrter saidianischer Orientalismus.“
In der Zeitung war auch von der Kritik einiger Gelehrter an dieser Entwicklung zu lesen: Clark Sorensen, Professor für Koreastudien an der University of Washington, sagte, dass er zwar verstehe, warum es jüngere Akademiker fasziniere, sich mit K-Pop zu befassen. Er selbst habe sich aber dazu entschlossen, sich nicht dieser Strömung anzuschließen, und er habe kein besonderes Interesse an diesen Forschungen, hieß es in dem Artikel.
„Trotz des Widerstands des Elfenbeinturms werden vielleicht die Gelehrten, die sich mit K-Pop beschäftigen, in der Diskussion siegen, da sich der wissenschaftliche Reiz des K-Pop innerhalb der akademischen Gesellschaft verbreitet”, hieß es abschließend in der Zeitung.
Von Chang Iou-chung
Redakteur, Korea.net
Foto: Screenshot des Artikels von der Internetseite des „Wall Street Journal"
icchang@korea.kr
Wie Sie richtig geraten haben, handelt es sich um einen Scherz. Der Wirtschaftswissenschaftler, der gern koreanische Fernsehserien mit seiner Familie ansieht, machte diesen Scherz erstmals während eines Dinners in Hualien, Taiwan, bei einer Konferenz über die nationalen Gesundheitssysteme von Korea und Taiwan. Auch wenn es nur ein Witz war, sagte er in einem späteren Interview, dass die Frage berechtigt sei, warum koreanische Fernsehserien so beliebt in China, Japan, Taiwan und vielen anderen Teilen Ostasiens sind und dass Soziologen und Psychologen diese Entwicklung untersuchen sollten.
Viele Gelehrte haben in der Tat damit begonnen, die jüngst entstandene Popularität koreanischer Popmusik, Kinofilme und Fernsehserien in Ostasien und anderswo zu untersuchen, ein Trend, den man „Koreanische Welle” oder in Kurzform „Hallyu” nennt. Immer mehr Akademiker erforschen diese Strömung, die zunächst als kurzfristiges Phänomen betrachtet wurde, nun aber länger anhält als erwartet.
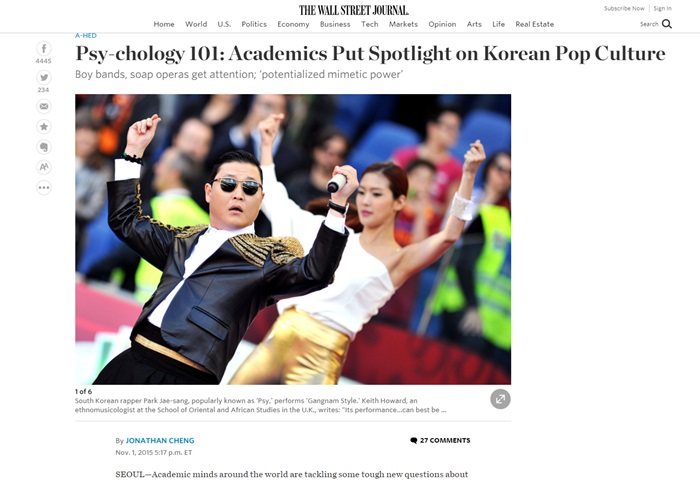
Intellektuelle aus aller Welt diskutieren über die „Neuinterpretation von Lokalität anhand des Lieds ,Gangnam Style‘ des koreanischen Rappers Psy“. Seit einiger Zeit ist in der akademischen Welt ein gesteigertes Interesse daran zu verzeichnen, sich mit der koreanischen Populärkultur zu befassen. Am 1. November wurde im „Wall Street Journal“ darüber berichtet.
Diese jüngste akademische Strömung, in deren Rahmen die koreanische Populärkultur beleuchtet wird, wurde am 1. November im „Wall Street Journal“ diskutiert. Die anhaltende Popularität von koreanischer Popmusik und koreanischen TV-Shows haben die Neugierde der akademischen Welt geweckt: Eine wachsende Zahl von Aufsätzen aus dem Bereich der Koreastudien (auch Koreanistik) konzentriert sich auf dieses Phänomen, so die Zeitung. Es werden fortlaufend weitere wissenschaftlich belegte Publikationen und wissenschaftliche Einzeldarstellungen herausgebracht, und die Themen in den Abhandlungen aus dem Bereich Koreastudien weichen nun von traditionellen Themen wie Buddhismus, Konfuzianismus und Patriarchat ab, hieß es.
Die Zeitung führte das Beispiel von Keith Howard an, eines Professors der School of Oriental and African Studies in London. Howard, dessen Forschungsgebiet die koreanische volkstümliche Musik ist, wurde bei einer Konferenz „niedergeschrien”, als er eine Abhandlung über koreanische Pop-Balladen präsentierte. Das war im Jahr 1999 bei der jährlichen Konferenz der Association for Korean Studies in Europe. Er ließ sich jedoch niemals entmutigen und führte seine Forschungen über die koreanische Popmusik fort. In seinem Aufsatz, der in diesem Jahr veröffentlicht wurde, analysiert er Psys „Gangnam Style” und kommt zu dem Schluss, dass er „eine potentialisierte nachahmende Kraft hat, wie eine Art umgekehrter saidianischer Orientalismus.“
In der Zeitung war auch von der Kritik einiger Gelehrter an dieser Entwicklung zu lesen: Clark Sorensen, Professor für Koreastudien an der University of Washington, sagte, dass er zwar verstehe, warum es jüngere Akademiker fasziniere, sich mit K-Pop zu befassen. Er selbst habe sich aber dazu entschlossen, sich nicht dieser Strömung anzuschließen, und er habe kein besonderes Interesse an diesen Forschungen, hieß es in dem Artikel.
„Trotz des Widerstands des Elfenbeinturms werden vielleicht die Gelehrten, die sich mit K-Pop beschäftigen, in der Diskussion siegen, da sich der wissenschaftliche Reiz des K-Pop innerhalb der akademischen Gesellschaft verbreitet”, hieß es abschließend in der Zeitung.
Von Chang Iou-chung
Redakteur, Korea.net
Foto: Screenshot des Artikels von der Internetseite des „Wall Street Journal"
icchang@korea.kr
Meist gelesene Nachrichten
- Japanischer Premierminister betonte die Beziehungen zwischen Korea und Japan
- K-Pop wurde auf Spotify in den letzten zehn Jahren um das 400-Fache mehr gestreamt
- Workshops für Honorary Reporter und K-Influencer stärken Medienkompetenz
- [INTERVIEW] Ini & Jong: Die Stimmen hinter „Wir reden die Welt“
- Animationsfilm “Kpop Demon Hunters” erobert Netflix
